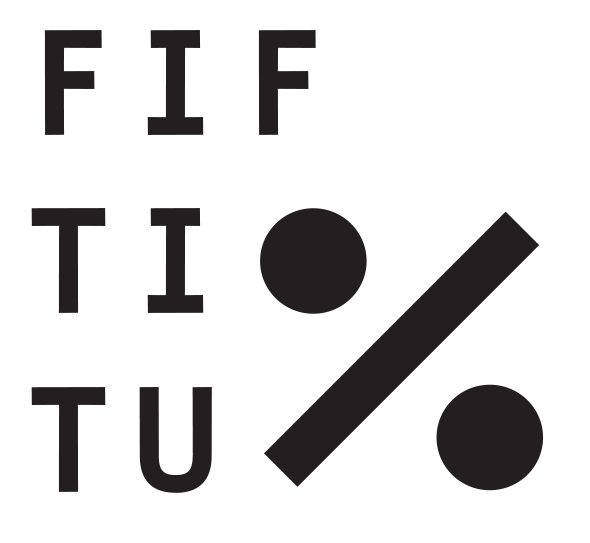Bericht einer Teilnehmerin
2011 standen bei FIFTITU% Gleichstellungpolitiken im Zentrum. Das FIFTITU%-Jahresprogramm mit dem Motto “Wir sind nicht alle gleich, aber manche sind gleicher” lief im afo – Architekturzentrum OÖ aus. In der letzten Veranstaltungsreihe ging es inhaltlich um Queerversity, Bildpolitiken und künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum.
Ein subjektiver Bericht.
Populäre Phantasien
Johanna Schaffer muss frau* und mann* nicht unbedingt vorstellen. Wer nur ein wenig Einblick in feministische Theorien hat, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ihre Forschungen gestoßen. Ihre Dissertationsarbeit trägt den bezeichnenden Titel “Ambivalenzen der Sichtbarkeit”. Sie geht dabei der Frage nach, welche Strukturen eine Sichtbarkeit, Ein- und Ausschlußmechanismen reproduzieren, d.h. wer ist sichtbar im Gesellschaftsgefüge und warum? In welcher Form passiert das und wie passiert die Reproduktion von Ungleichheit? Schaffer bezieht sich in ihrem Vortrag im afo konkret auf zwei Positionen die ihrem Wesen nach widersprüchlich und unvereinbar sind, aber trotzdem gemeinsam verhandelt werden müssen: Sie spricht über die Notwendigkeit rechtlicher Instrumente, mit denen strukturelle Ungleichheit angefochten werden kann. Paradox und zusammenhängend ist dabei aber, dass frau* und mann* um die fehlende Treffsicherheit solcher rechtlicher Instrumente weiss und damit Dissens, Konflikt und Unsicherheit einhergehen. Wer dran bleibt, muss offen bleiben für Paradoxien und Unsicherheiten.
Mediale Entscheidungen oder Decolonize your Mind
Schaffer diskutiert im Vortrag die Sichbarkeit von Ungleichheit anhand von Film- und Bildanalysen. Die preisgekrönte Arbeit von Marissa Lobo trägt den Titel "Iron Mask, White Torture" und ist medial komplex. Die Künstlerin hat dafür verschiedene Medien genutzt, um auf eine rassistische und sexistische Problematik in einer künstlerischen Intervention aufmerksam zu machen: Neun schwarze Aktivistinnen nehmen die Identität der Anastasia, die in tradierten Erzählungen bis ins Religiöse und Mythologische verklärt ist, an. Mit der Austauschbarkeit der Identität kommt es zum Bruch der klassischen Erzählung. Irritation. Diese Anastasias sprechen nun für sich selbst und sind keine Erzählungen mehr - damit wird die Geschichte der Anastasia in die Gegenwart geholt. Ein Kunstgriff, der es erlaubt, aktuelle Ungleichheit zu thematisieren: Erzählt selbst, anstatt erzählt zu werden, im Jetzt, aus der individuellen Position heraus. Lobos Arbeit erzählt die kollonialen Kontinuitäten rassistischer und sexistischer Gewalt in Österreich anhand der Figur der Anastasia. Das Bemerkenswerte, das in dieser Arbeit aber offenbart wird, ist: In den klassischen Medien existiert eine große Abwesenheit feministischer und antirassistischer Inhalte. Die hegemoniale Reproduktion weisser Geschichte und deren ungebrochenen Verleugnungstendenzen sind populär und werden stetig reproduziert.
Schaffer argumentiert, wenn etwa schon UniversitätsprofessorInnen, TheatermacherInnen und BildungsministerInnen auf strukturelle Gewalt nicht Stellung beziehen, dann muss die Antwort auf diese Mißstände in Gleichstellungszielen liegen. Es ist ein rechtliches Einfordern allgemeiner gesellschaftlicher Ziele. Das passiert zum Beispiel in Form arithmetischer Festschreibungen, wie den Quotenregelungen. Auch hier tritt die Anfangs beschriebene Crux auf: mit dem Hinweis auf Marginalisierung und Diskriminierung wird eine Wiederholung derselben erzeugt. Auch das Filmgenre MigrantInnen-Drama hat mit diesem Problem zu kämpfen, da es sich auf diese Stereotypisierungen einläßt. Populäre Phantasien, wie sich die sogenannte oder selbsternannte Mehrheitsgesellschaft ein migrantisches Leben erdichtet und sich damit ihrer vermeintlichen Mehrheit rückversichert, werden hier deutlich. Nicht selten wird im MigrantInnen-Drama der weisse Mann zum Retter eines türkischen Mädchens! Es wird eine prekäre Position reproduziert und wiederholt, indem Klischees bemüht werden. Das Subgenre MigrantInnen-Drama will rassistische Diskriminierung aufzeigen, bleibt aber in diesem Kreislauf. Es ist also notwendig dieses Paradoxon zwar hinzunehmen und zu erkennen, aber durch die Tat des für sich selbst Sprechens kann und soll eine solche eindimensionale Benennung und Reproduktion überwunden werden. Auch im Bereich Quotenregelung ist das der Fall: zwar ist die Quotenfrage noch immer notwendig, doch auch in ihr liegt diese Paradoxie zugrunde. Ein Umstand, der im Bewußtsein bleiben sollte, weil er ständiger Korrektur und Überwindung bedarf. Jede Personengruppe, die sich als diskriminiert betrachtet, muss sich mit dieser Zuschreibung auseinandersetzen und soll sie im nächsten Schritt überwinden. Selbst sprechen, die eigene Geschichte erzählen und sein Recht in Anspruch nehmen: die paradoxe Gleichzeitigkeit von unzureichender Zuschreibung und dem Anspruch sich davon zu lösen. Ein ständiger Spagat zwischen den zwei Ebenen rechtliche Grundlagen und gesamtgesellschaftliche Fragen der Zuschreibungen.
Das schlechte Beispiel: Sprechen über Andere
Rhetorische Gewalt in einer vermeintlichen Fürsorglichkeit? Solche Taten kennt frau* und mann* von Seiten der Politik. Nur ganz kurz und mit Widerwillen stellte Schaffer: "Um das gleich wieder wegzutun" ein Plakat der FPÖ zur Disposition. Das ist auch verwunderlich, da die FPÖ eigentlich keine Frauen- oder Kulturpolitik hat. In dem Plakatsujet der FPÖ bemüht sich also H.C. Strache um muslimische Frauen, die vom sogenannten Kopftuchzwang gerettet werden müssen. Und dabei dachten wir, Kirche und Staat seien längst getrennt. Das Motiv ist klar, frau* und mann* erkennt die Absicht und ist verstimmt. Das populäre, wie schwierige Artefakt Kopftuch wird ohne Kontext zur Disposition gestellt. Diese Nicht-Politik ist gegen Alles, was nicht dem "mia san mia" entspricht. Es ist kein Inhalt, den die Polis verhandelt hätte. Es ist eine Abwertung und Diskreditierung ohne Hintergrund – ausgenommen dem tradierten Klischee. Eine Abwertung, weil ohne Diskussion. Eine Abwertung, weil ohne politische Anschlußfähigkeit.
Was jetzt?
Gleichstellungspolitik funktioniert in einer Paradoxie. Die Trennlinien und Bruchlinien in der Gesellschaft werden mit den rechtlichen Mitteln der Equality Targets zwar verschoben, korrigiert und thematisiert, müssen dabei aber auch Überwunden werden, und dabei die eigene Position deutlich machen. Der Anspruch liegt in der gesellschaftlichen Veränderung. Weil Hegemonie etwas ist, das nicht der erfahrbaren Wirklichkeit entspricht. Der Bruch mit hegemonialer Macht ist reale Politik, die nichts mit Parteien und Wahlen zu tun hat. Es ist eine Politik des Selbst gemeint, die sich mehr für die Praxen, als für Identitäten interessiert. Es ist ein Eintreten gegen die Verfestigung von Identitäten und von Opferrollen, die von Außen zugeschrieben sind. Wir und die Anderen war gestern, und ohnehin dauerte diese Alterität viel zu lange an.
Und eine weitere Crux stört eine gleichberechtigte Teilhabe. Zwar ist das Leben eine individuelle Verantwortung, doch sie ist gesellschaftlichen Strukturen unterworfen, die aktuell vor dem Hintergrund einer Markt- und Leistungslogik argumentiert wird. Die neoliberalen Argumentationen von Leistungslogik sind schwierig, da sie Freiheit und Gleichwertigkeit nur suggerieren, da sie (1) die strukturelle Ungleichheit verschweigen und negieren und darüber hinaus (2) die Leistungslogik als Grundvorraussetzung annehmen. Quasi, Sie können ein “wertvolles” Mitglied “unserer” Gesellschaft sein, wenn Sie ihren “Beitrag” (= Leistung) nachweisen. Vielleicht ist deshalb auch der Begriff oder rechtliche Status “Ayslwerberin” prekär, weil das Werben die Flucht verschleiert?
Queerversity, so Schaffer, ist eine theoretische, wie praktische Strategie einer politischen Umsetzung, die sich in Entwicklung befindet. Queerversity widerspricht der ökonomischen Diktion, die sich über soziale Belange erhoben hat. Queerversity überwindet Norm und Abweichung, indem Differenzen und Unterschiede ein fortdauerndes Werden bedeuten: Dynamische Prozesse ermöglicht, das Gewahrwerden von Vielfalt (Multitude) fördert und undefinierte Andersheit aushalten lernt.
Willkommen in einer Welt, in der die alten Sprechgewohnheiten scheitern!
Ein Workshop im afo
Am folgenden Tag, nach dem Vortrag von Johanna Schaffer, hielten die beiden Wiener Künstlerinnen Marissa Lobo und Iris Borovčnik einen Workshop ab. Das FIFTITU% Organisationsteam ist bedacht und freundlich: will frau den Tag einem Workshop widmen, dann wird die Teilnehmerin auf allen erdenklichen Seiten dazu unterstützt. Und das bedeutet Kinderbetreuungsgeld, Fahrtkostenzuschuss, ein barrierefreies Haus, ein Hinweis, dass die Geschehnisse gefilmt und dokumentiert werden. Es ist trotz der medialen Begleitung ein intimer Rahmen.
Strategien kritisch-künstlerischer Praxen
Unter diesem Titel lief der Workshop von Marissa Lobo und Iris Borovčnik. Raum einzunehmen und mittels künstlerischer Interventionen die eigentlichen, die eigenen, vielleicht auch marginalisierten Inhalte zu lancieren, ist das Ziel.
Im Telefoninterview für die FIFTITU%-Sendung “52 Radiominuten” auf Radio FRO wurde Marissa Lobo gefragt, wie es aus ihrer Sicht um die Aktionismuskultur in Österreich bestellt ist. Ihre Antwort kam unvermittelt und lautet sinngemäß: “Der gemeinsame, öffentliche Raum ist ein kontrollierter.”
Verstörung und Parodie
Was Johanna Schaffer auf theoretischer Ebene vermittelt hat: die Chancen einer queertheoretischen Haltung auszuloten, soll hier in der Praxis probiert werden. Wie geht das? Gibt es eine Handlungsanleitung, die wie ein Algorithmus funktioniert? Wo fangen wir an, wenn jede* und jeder* Fall eine eigene Positionierung verlangt?
Das ist der Punkt, an dem die Künstlerinnen ansetzen. Kenne die eigene Position und treffe eine Unterscheidung. Es geht dabei zuerst um eine Bewußtwerdung der hegemonialen Sprache und Denkart. Wir haben es uns mehr oder weniger in dieser festgeschriebenen Wirklichkeit behaglich eingerichtet, oder auch nicht. Zumindest aber meinen wir, die Wirklichkeit zu kennen und damit beginnt das Problem: das Vertraute verschleiert die Umstände. Der blinde Fleck. Die Betriebsblindheit. Das Klischee, über das nicht mehr nachgedacht wird. Das Aufwärmen am sozialen Lagerfeuer. Ende und Starre durch scheinbare Gewissheiten. Langeweile. Unbemerkte Ungleichheit. Kontrolle. Wir diskutieren im Workshop diese Phänomene. Diese Phänomene aber sind bei genauerer Betrachtung soziale Tatbestände. Wir beschreiben uns jede selbst mit bekannten Attributen und Zuschreibungen als Studentin, Frau, Linke, als Slackerin, als Ausländerin, als Chaotin, als prekär lebend ... am Ende sitzen wir mit den Zuschreibungen, die wir auf Zetteln auf den Körper geheftet haben im Kreis: Das Ich zerfällt und wird vieles. Je nachdem. Was willst du, das ich für dich bin? Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung befinden sich in einem Wechselspiel. Die private Wirklichkeit ist kein Resultat einer individuellen Entscheidung. Das ist eine unangenehme Erkenntnis. Sagt doch das Ich zu mir, das ich es bin, die hier am Werk ist.
Das Ende der Dialogkultur
Wir lesen Texte und zerdröseln sie. Wer spricht hier? Was sagt der Text? Und wie kann der Text weitererzählt werden? Und was passiert nach dem Ende der Dialogkultur?
“Der Dildo ist nicht der Phallus und er repräsentiert nicht den Phallus, weil der Phallus nicht existiert. Er muss auch nicht abgeschnitten werden, weil es sich bei ihm ohnehin nur um eine stark vergrößerte Klitoris handelt, angeschwollen lediglich, um dem Vorbild des Dildos zu genügen.”
Wir sehen uns Filme künstlischer Interventionen an: Kanak Attack, Coco Fusco, Voina, Maria Galindo, die Arbeit “White Torture” von Marissa. Kanak Attack geht mir irgendwie an die Nieren. Die Protagonistin im Video konfrontiert die PassantInnen mit der Frage: “Wie lebt es sich hier im weissen Ghetto?” Eine Passantin reagiert schüchtern und ausweichend: “Wie?” “G-H-E-T-T-O! Wie leben Sie im weissen Ghetto?!” Meine zivilisisatorisch fest verankerte Freundlichkeit und das Was-sich-gehört-und-was-nicht melden sich in meinem Kopf zu einem Streitgespräch an. Kanak Attak funktioniert, auch bei mir. Frei nach Brecht: Zuerst die Freundlichkeit und dann die Moral? So funktioniert eine Intervention nicht. Sie darf auch weh tun, wie das Denken.
Wir diskutieren, sehen Filmmaterial durch, wir verlieren den Zeitplan, wir probieren eine Intervention aus der Hüfte zu schiessen. Alles ertrinkt in Diskussionen. Auch darüber was nun legitim ist, wo die Grenzen liegen und ob – nun anläßlich des 9. November – das Thema Novemberpogrome eine Option wäre.
Wir beenden den Workshop ohne eine gemeinsame Intervention im öffentlichen Raum getan zu haben. Neben dem Zeitproblem, war es eine gewisse Hemmschwelle, mit der die Gruppe kämpfte. Ein interessante Situation, und so bezeichnend. Der öffentliche Raum, so Marissa, ist ein kontrollierter. Und wir, wir wissen vor allem was sich gehört – und was nicht.
Ein Text von REH IN WUT
Graphik: Jo Schmeiser